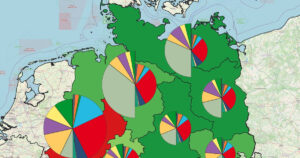Ein Jahr nach seinem großen Bericht über die Wettbewerbsfähigkeit Europas hat Mario Draghi in Brüssel erneut Bilanz gezogen. Seine Rede auf der High Level Conference war eine klare Bestandsaufnahme – aber auch ein Weckruf. Europa, so seine Einschätzung, verliere an wirtschaftlicher Schlagkraft, weil es zu langsam, zu kleinteilig und zu teuer agiere – besonders in der Energiepolitik.
Für Draghi ist Energie längst kein reines Klimathema mehr, sondern eine Frage der industriellen Existenzfähigkeit. Gas sei in Europa weiterhin rund viermal, Strom etwa doppelt so teuer wie in den USA. Diese Preisschere schwäche die industrielle Basis des Kontinents – vor allem in energieintensiven Branchen wie Chemie, Stahl oder Papier. Die Ursachen lägen nicht nur im Wegfall russischer Lieferungen, sondern in strukturellen Defiziten: fragmentierte Märkte, unkoordinierte Subventionen, schleppende Netzausbauten und komplexe Regulierungen.
Vom Ausbau zur Systemwende
Draghi fordert, die Energiewende als Systemaufgabe zu begreifen. Mehr Wind- und Solarparks allein reichen nicht, wenn Netze, Speicher und Grundlasttechnologien nicht mithalten. Europa brauche eine strategische Energieinfrastruktur, die Erzeugung, Transport und Speicherung integriert.
Dazu gehören aus seiner Sicht massive Investitionen in Stromnetze und Interkonnektoren, der beschleunigte Ausbau von Speicher- und Flexibilitätslösungen (Batterien, Wasserstoff, Demand Response) sowie schnellere Genehmigungsverfahren.
Bemerkenswert ist Draghis pragmatischer Ansatz: Er plädiert für eine technologieoffene Debatte, in der auch Kernenergie oder CO₂-Speicherung als Übergangstechnologien eine Rolle spielen dürfen, solange sie zur Versorgungssicherheit beitragen.
Energiepreise als industriepolitische Stellschraube
Draghis Analyse berührt einen Punkt, der in den kommenden Jahren zentral werden dürfte: Unternehmen brauchen planbare Energiepreise, um investieren zu können. Er spricht in diesem Zusammenhang von der Notwendigkeit langfristiger Preisverträge und nennt Contracts for Difference (CfDs) ausdrücklich als Instrument zur Stabilisierung der Strompreise. Auch andere langfristige Vereinbarungen – wie Power Purchase Agreements (PPAs) – lassen sich in diesen Kontext einordnen, auch wenn Draghi sie nicht explizit erwähnt.
Solche Mechanismen könnten helfen, Preissicherheit herzustellen und Investitionen sowohl auf Seiten der Industrie als auch der Energieerzeuger abzusichern. Eine europaweit einheitliche Anwendung solcher Instrumente wäre ein wichtiger Schritt hin zu mehr Marktstabilität.
Investieren – aber gemeinsam
Draghi beziffert den Investitionsbedarf der europäischen Energiewende auf rund 1,2 Billionen Euro pro Jahr bis 2031, davon etwa die Hälfte aus öffentlichen Mitteln. Sein Appell: Diese Mittel müssen gezielter, gemeinsamer und produktivitätsorientierter eingesetzt werden. Nationale Förderprogramme ohne strategische Koordination führten zu ineffizienter Mittelverwendung und Wettbewerbsnachteilen.
Er fordert deshalb eine neue europäische Finanzierungsarchitektur für Energieinfrastruktur – mit Priorität für Projekte, die Versorgungssicherheit, Wettbewerbsfähigkeit und Dekarbonisierung gleichermaßen stärken.
Ein europäischer Pragmatismus
Draghis Rede lässt sich als Aufruf zu mehr Realismus verstehen: Europa muss Energiepolitik, Industriepolitik und Sicherheitspolitik künftig gemeinsam denken. Sein Ansatz ist nicht unumstritten – gerade weil er stark auf Zentralisierung und gemeinsame Finanzierung setzt. Dennoch enthält seine Analyse eine klare Richtung: Nur wenn Europa seine Energiesysteme effizienter, integrierter und marktnäher gestaltet, kann es seine industrielle Basis erhalten.
Einordnung aus Sicht der Praxis
Für Akteure im Energiemarkt bedeutet das: Die Zeit der nationalen Einzelstrategien geht zu Ende. Projekte, die regionale Erzeugung mit industriellem Verbrauch verbinden und Versorgungssicherheit durch langfristige Verträge schaffen, werden an Bedeutung gewinnen.
Gerade Windstrom-PPAs können in diesem Umfeld eine Schlüsselrolle spielen – nicht als politisches Instrument, sondern als marktwirtschaftlicher Mechanismus, der Erzeugern Stabilität und Abnehmern Preissicherheit bietet. In einer Phase wachsender Unsicherheit könnten solche Modelle zum Rückgrat einer europäischen Industrieversorgung werden.